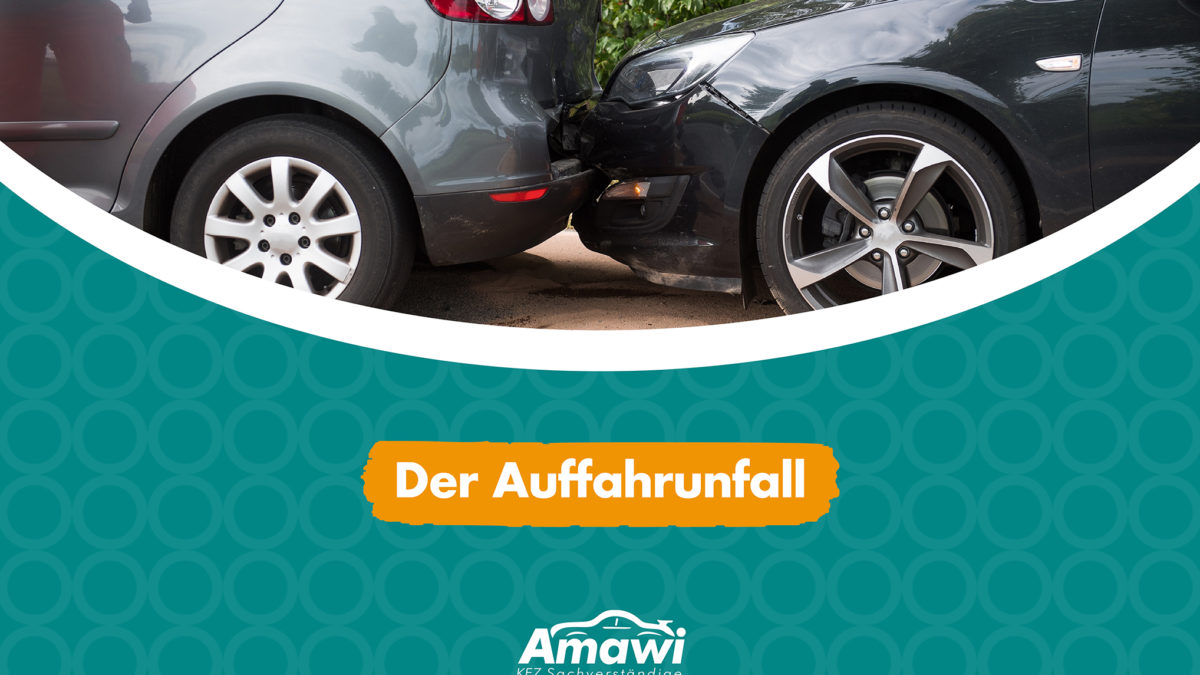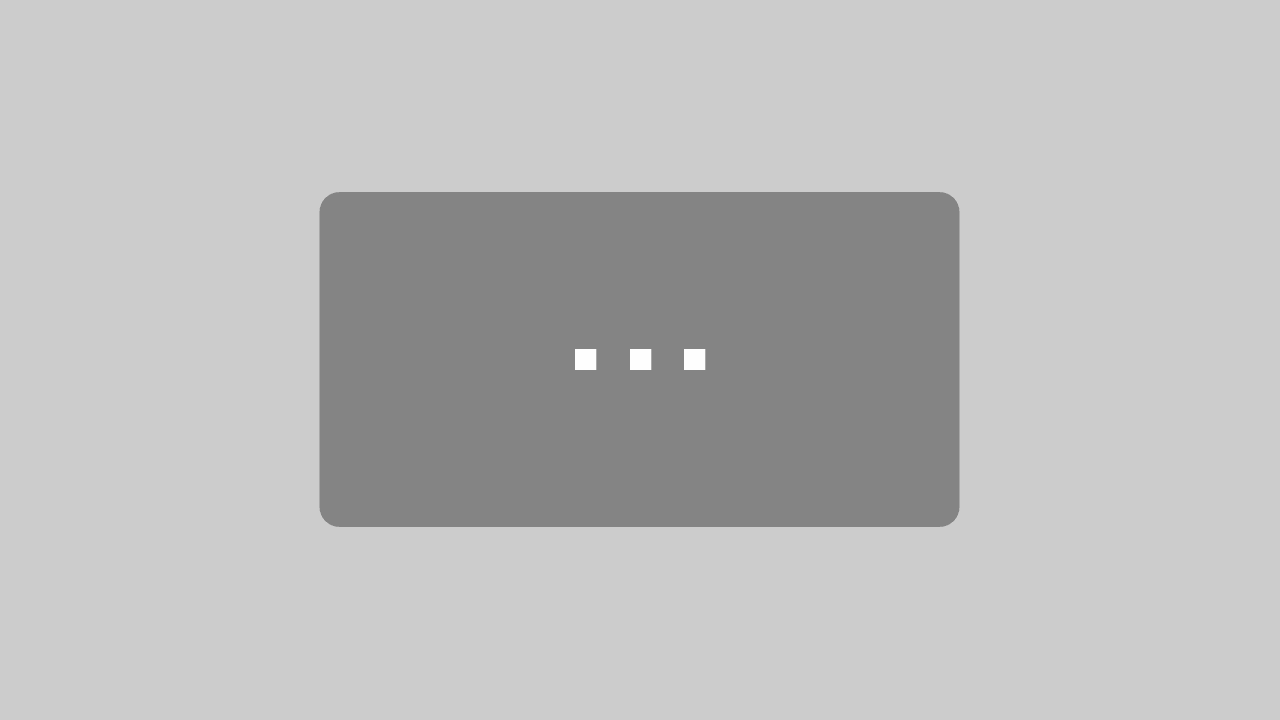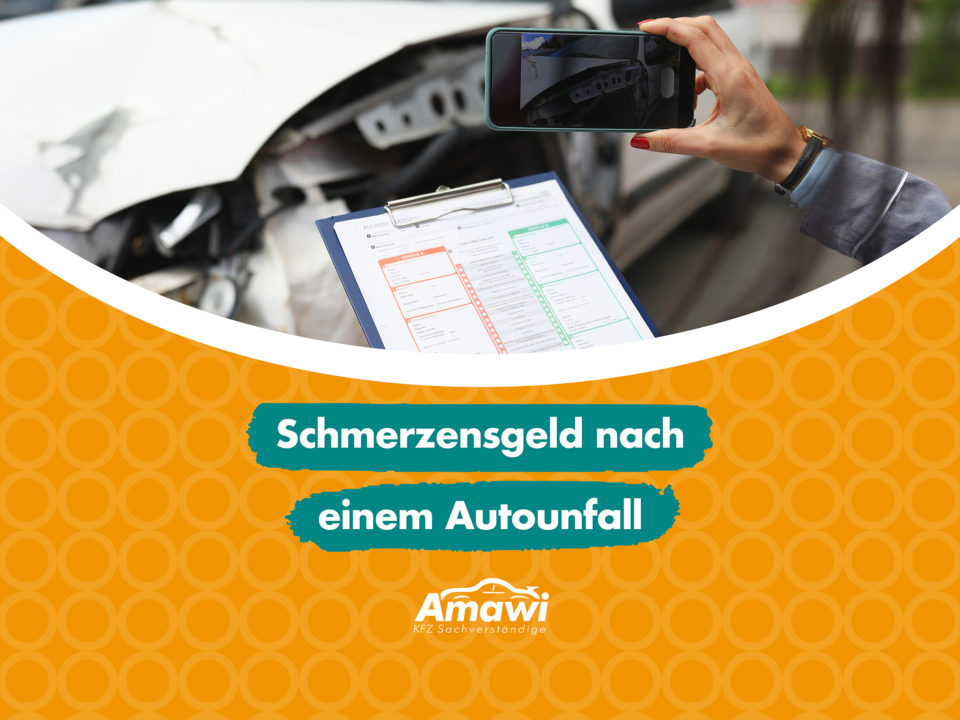Ein kurzer Blick zum Beifahrer oder das schreiende Kind auf dem Rücksitz – im Bruchteil einer Sekunde kann eine kleine Unaufmerksamkeit zu einem Auffahrunfall führen. Nach dem Zusammenstoß ist der Schreck meist groß und die Unfallbeteiligten sind verunsichert, wie sie sich nun verhalten sollten. Wir zeigen Ihnen hier auf, was Sie beachten müssen und welche Schritte eingeleitet werden sollten, egal, ob Sie Unfallverursacher oder Unfallgeschädigter sind
Seitenübersicht
Das Wichtigste vorab in Kurzform
- Auffahrunfälle passieren meist aufgrund von zu geringem Sicherheitsabstand oder zu hoher Geschwindigkeit und bei Unaufmerksamkeit.
- Es ist bei einem Autounfall nicht immer schuld, wer auffährt. Manchmal gibt es Gründe für eine Teilschuld für alle Unfallbeteiligten.
- Als Unfallgeschädigter sollte man unbedingt einen Kfz Gutachter beauftragen, um Ansprüche fundiert und vollständig durchsetzen zu können.
- Das Unfallgutachten ist für den Geschädigten kostenlos, da es von der Versicherung des Unfallverursachers bezahlt wird.
- Grundsätzlich sollte bei einem Unfall Ruhe bewahrt, die Unfallstelle abgesichert, bei Bedarf Hilfe organisiert und eine Unfalldokumentation angefertigt werden.
Auffahrunfall – Was tun?
Wir haben hier die wichtigsten Tipps zusammengestellt, was nach einem Auffahrunfall unbedingt zu beachten ist:
Ruhe bewahren & Unfallort absichern

Das Warndreieck sollte ca. 100-400 Meter hinter der Unfallstelle aufgestellt werden.
Bewahren Sie zunächst unbedingt Ruhe und sichern Sie die Unfallstelle ordnungsgemäß ab. Gehen Sie dabei wie folgt vor:
- Schalten Sie den Warnblinker ein und ziehen Sie Ihre Warnweste an.
- Sichern Sie die Unfallstelle mit einem Warndreieck ab (Entfernung: 100 m bis 400 m, je nach Verkehrsfluss und örtlicher Begebenheit).
- Stellen Sie fest, ob es Verletzte gibt und leisten Sie bei Bedarf Erste Hilfe.
- Informieren Sie Rettungskräfte und die Polizei bei verletzten Personen und schweren Schäden.
- Fotografieren Sie die Unfallsituation sowie die entstandenen Schäden.
- Tauschen Sie mit dem Unfallgegner Adressen und Informationen zur Versicherung aus.
- Erstellen Sie einen Unfallbericht und eine Unfallskizze.
- Bei einem Autounfall im Ausland: Europäischen Unfallbericht ausfüllen.
Unser Tipp: Drucken Sie diese Checkliste aus und legen Sie ins Handschuhfach! Dann können Sie bei einem Unfall einfach die Liste abhaken.
Wann muss bei einem Auffahrunfall die Polizei verständigt werden?
Wurden beim Unfall Personen verletzt, müssen Sie grundsätzlich die Polizei verständigen. Liegen jedoch lediglich Blechschäden vor, ist dies nicht unbedingt erforderlich. Bei einem leichten Auffahrunfall könnten Sie somit auf einen Anruf bei der Polizei verzichten. Allerdings kann die Einschaltung der Polizei durchaus ratsam sein, damit der Verkehrsunfall von offizieller Seite ordnungsgemäß dokumentiert wird. Falls das Fahrzeug Ihres Unfallgegners in einem anderen Land zugelassen ist, sollten Sie keinesfalls auf die Einschaltung der Polizei verzichten.
Auffahrunfall – Was tun als Geschädigter?
Als Unfallgeschädigter haben Sie das Recht, einen unabhängigen Sachverständigen zur Begutachtung des Fahrzeugs zu beauftragen. Diese Kosten und auch die Rechnung für einen Anwalt für Verkehrsrecht übernimmt (neben den Reparaturkosten) die gegnerische Versicherungsgesellschaft. Der Gutachter kann auf Wunsch für Sie auch die gesamte Abwicklung mit der Versicherung übernehmen. Wurden Sie beim Unfall verletzt, steht Ihnen zudem möglicherweise ein Schmerzensgeld von der Versicherung zu. Insbesondere bei Streitigkeiten hinsichtlich der Schuldfrage ist ein Fachanwalt für Verkehrsrecht eine große Hilfe. Ihr Anwalt wird auf eine korrekt durchgeführte Abwicklung achten und diese koordinieren.